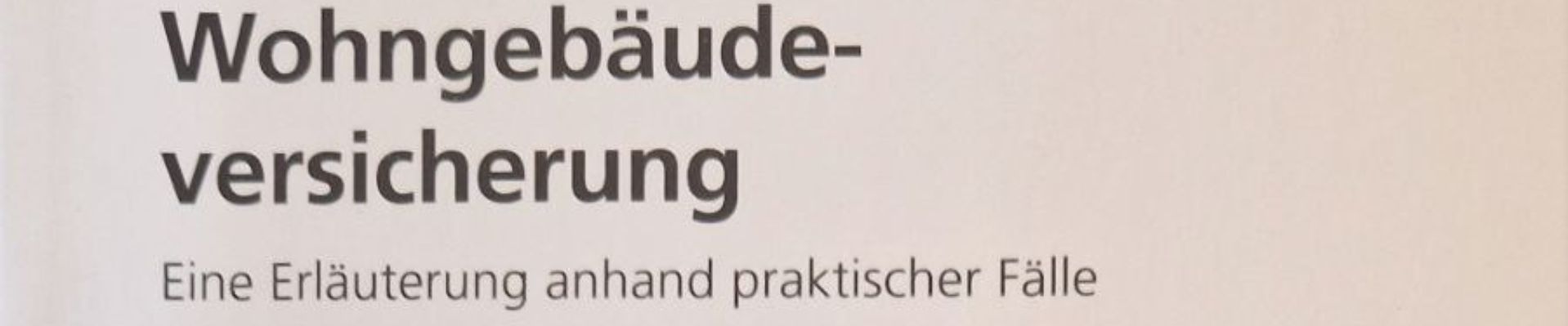Lemberg, Jrg und Luksch, Andreas: Wohngebudeversicherung. Eine Erluterung
anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft), 3. Auflage, 2024, 222 Seiten, 34,80 Euro, Softcover
Gegenber der zweiten Auflage aus dem Jahre 2020 wurde die Neuauflage vollstndig berarbeitet. Grundlage sind die fr die Ausbildung von Versicherungskaufleuten aktuellen Proximus-5-Bedingungen zur Wohngebudeversicherung. Dort, wo sich die Proximus-Bedingungen von den unverbindlichen Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) unterscheiden, wird jeweils speziell darauf hingewiesen (siehe z. B. S. 19).
Musterbedingungen als Ausbildungsstandard
Insgesamt folgt das Buch in seiner Struktur jener des ebenfalls 2024 erschienenen Grundlagenwerkes Hausratversicherung. Eine Erluterung anhand praktischer Flle. Natrlich ohne die hausratspezifischen Themen, wie etwa die Bestimmungen zur Auenversicherung.
Bereits in der Einleitung (S. 1) wird erlutert, weshalb das Grundlagenbuch nicht auf den realexistierenden Bedingungen eines einzelnen Versicherers, sondern auf denen der fiktiven Proximus AG beruht. Wie bei der vergleichbaren Einfhrung der Autoren in die Hausratversicherung beschreibt die Einleitung auch hier das Produkt Wohngebudeversicherung erst einmal in seinen groben Linien. Dabei wird insbesondere sehr anschaulich auf die Unterschiede zwischen leichter und grober Fahrlssigkeit bzw. (bedingtem) Vorsatz eingegangen.
Versicherte Gefahren grundlegend beschrieben
Die eigentliche Lektre beginnt ab Seite 9 mit den versicherten Gefahren. Diese werden in ihrem Umfang anhand zahlreicher Beispiele erlutert, wobei immer wieder bercksichtigt wird, ob ein konkreter Schaden eine versicherte Sache geschdigt hat, ob eine versicherte Gefahr eingetreten ist und auch ob etwaige Obliegenheitsverletzungen oder Ausschlsse den Versicherungsschutz versagen.
So wird etwa bei einem exemplarischen Brandschaden, verursacht durch einen eiferschtigen Ex-Freund, hinterfragt, ob hier der Ausschluss fr eine vorstzliche Herbeifhrung des Versicherungsfalles einschlgig sein knnte. Hierbei stellen die Autoren allerdings klar, dass es nicht auf den Willen des Brandstifters, sondern auf den der Versicherungsnehmerin ankomme. Da diese den Schaden nicht wollte, greife auch nicht der Ausschluss fr Vorsatztaten (siehe S. 10 – 12):
Fraglich ist aber, ob der Versicherer nach 81 Abs. 1 VVG aufgrund der vorstzlichen Handlung des Hasso von der Leistungspflicht frei sein knnte. Dafr msste Hasso allerdings Versicherungsnehmer gewesen sein. Dies ist nicht der Fall, denn Wiebke ist Versicherungsnehmerin und sie selbst hat den Schaden nicht verursacht.[1]
Fr die Vertriebspraxis wichtig ist auch der Hinweis zum Thema Explosionsschden. Hier komme es nicht darauf an, ob sich das Ereignis auf dem Versicherungsgrundstck ereignet habe oder vielmehr im Nachbarhaus (S. 16). Obwohl viele Wohngebudetarife mittlerweile Explosionsschden durch Blindgnger ausdrcklich als mitversichert benennen, ist der Hinweis von Lemberg und Luksch auf eine generelle Mitversicherung in solchen Fllen (siehe S. 16) hilfreich.
Undichte Silikonfugen werden thematisiert
Im Zusammenhang mit der Darstellung der Gefahr Leitungswasser erlutern die Autoren unter anderem, was unter einem Reprsentanten des Versicherungsnehmers zu verstehen ist und welche Voraussetzungen fr eine Versicherungsleistung der Kostenposition Wasserverlust vorliegen mssen (S.29 – 30). Darber hinaus wird auch auf das Fugenurteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 20.10.2021 (Az.ZR236/20) eingegangen. (S.30 – 31) Es wird auch erlutert, dass mittlerweile verschiedene Wohngebudeversicherer im Unterschied zu den unverbindlichen Musterbedingungen von Proximus sowie GDV hier einen Versicherungsschutz auch fr solche Flle anbieten. Die Aussage gegen Mehrbeitrag (S.30) muss man allerdings etwas relativieren. In der Regel wird diese Leistung tarifabhngig generell und ohne Mehrprmie gewhrt.
Sehr zu begren ist es, dass die Autoren in einer ihrer Funoten (siehe z. B. S. 31 Fn. 50) auch andere Rechtsansichten als ihre eigenen zur Auslegung eines Themas benennen.
Pdagogischer Aufbau der Einfhrungen in die Sachversicherung
Wenig verwunderlich fllt bei der Darstellung der versicherten Gefahren auf, dass mitunter nahezu wortgleiche Schadenbeispiele wie im Werk zur Hausratversicherung gewhlt wurden (siehe z. B. Schadenbeispiel 7 zum Thema Leitungswasser in der Wohngebudeversicherung (S. 34) entspricht Beispiel 5 (S. 44) in der Hausratversicherung). Da es sich um zwei Sachversicherungsprodukte handelt, die in Teilen eng miteinander verzahnte Risiken darstellen, ist es aus pdagogischer Sicht gewiss sinnvoll diese Gemeinsamkeiten durch gleichlautende Fallbeispiele zu verdeutlichen.
Zu Recht weisen die Autoren auf S.38 auf das Urteil des BGH vom 12.07.2017 (Az.IVZR151/15) bei unklarer Zustndigkeit des Versicherers bei Eintritt eines sich erst nach geraumer Zeit sichtbaren Schadens ein (S.38 – 39). Hierzu sei noch erwhnt, dass infolge dieses Urteils mittlerweile sehr viele Versicherungstarife ausdrcklich eine unklare Zustndigkeit bei Versichererwechsel bedingungsseitig geregelt haben. Ein entsprechender Hinweis wre schn gewesen.
Geringfgige Abweichungen sind hinzunehmen
In der Praxis gibt es immer wieder Probleme, wenn bei der Behebung von Schden leichte optische Beeintrchtigungen zurckbleiben. Dies kann z.B.der Fall sein, wenn zur Behebung eines Leitungswasserschadens einzelne Fliesen eines Badezimmers zerstrt und dann durch neue ersetzt werden mssen. Wer nun von seiner Versicherung erwartet, dass zur Vermeidung selbst geringfgiger Abweichungen des bisherigen Fliesenspiegels das ganze Bad auf Kosten des Versicherers neu gefliest wrde, sollte sich mit der Rechtsprechung vertraut machen:
Eine verbleibende geringfgige Abweichung zu den restlichen im Bad verbliebenen Fliesen ist nach Ansicht des Landgerichts Dsseldorf dem Versicherungsnehmer durchaus zumutbar. Entscheidend ist, was ein nicht versicherter Gebudeeigentmer investiert htte. Eine optische Beeintrchtigung knnte auch durch einen Wertminderungsausgleich kompensiert werden.[2]
Moderne Bedingungen nicht immer vorteilhaft
Kunden mit einem lteren Bedingungswerk werden gegebenenfalls von einem Hinweis auf S. 42 profitieren, der auf das Urteil des BGH vom 25.03.1998 (Az. IV ZR 137 / 97) verweist. Damals sei klargestellt worden, dass auch Rohre unterhalb der Bodenplatte als innerhalb des Gebudes anzusehen seien. Neuere Bedingungswerke stellen daher nachteilig fr die Versicherten klar, dass Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte nicht versichert seien. Um solche Rohre zu versichern, mssten also auch entsprechende Rohre auerhalb von Gebuden in den Versicherungsvertrag aufgenommen werden (S. 42 – 43).
Mehrwerte aktueller GDV-Musterbedingungen
Bei der Darstellung der erweiterten Naturgefahren (Elementargefahren) wird kurz (S. 61) auf eine weitergehende Versicherung auch unbenannter Gefahren eingegangen, allerdings ohne konkret auf die Seiten 202 bis 203 zu diesem Thema zu verweisen. Leider fehlt an dieser Stelle ein konkretes Beispiel speziell fr die oft strittigen Schden durch Teilberschwemmung wie sie nach den aktuellen Musterbedingungen des GDV mit Stand 11.2023 zumindest eingeschrnkt als mitversichert gelten. Vermutlich einem Versehen geschuldet ist, dass sich der Eintrag zu den unbenannten Gefahren zwar aus dem Stichwortverzeichnis am Ende des Buches, nicht jedoch aus dem Inhaltsverzeichnis an dessen Anfang erschliet.
Wie bereits in der ersten und zweiten Auflage und anders als im Rahmen der Rezension zur zweiten Auflage angekndigt – sind mgliche Abgrenzungsprobleme der gegen Zuschlag versicherbaren Naturgefahren weiterhin unbercksichtigt geblieben. Zum besseren Verstndnis hierzu ein Beispiel aus der Schadenpraxis:
Bei einem Kunden hat Starkregen dazu gefhrt, dass sich Regenwasser im Eingangsbereich einer Hintertr gesammelt hat. Durch den Anstieg des Wassers drang dieses unter der Tr in das Gebude ein. Da Teile des Grundstcks abschssig waren, lag hier keine versicherte berflutung des Grund und Bodens, auf dem das Gebude steht, in dem sich die versicherten Sachen befinden, mit erheblichen Mengen von Oberflchenwasser [.] durch Witterungsniederschlge vor. Damit wurde die im konkreten Fall vorliegende berschwemmungsdefinition nicht erfllt. Htte der Kunde an dieser Stelle unbenannte Gefahren mitversichert, lge zwar keine versicherte berschwemmung vor, hingegen htte sich eine unbenannte Gefahr als Schadenfall verwirklicht.
Inselanlagen als Sonderfall
Die Seite 65 thematisiert neben anderen versicherten Sachen auch Photovoltaikanlagen. Hier wre ein Exkurs wichtig, der erlutert, welchen Mehrwert eine separate Photovoltaikversicherung gegenber einem laut Proximus-Bedingungen nur optionalen Mitversicherung im Rahmen einer Wohngebudeversicherung hat. Siehe z. B. https://critical-news.de/tarifanalyse-photovoltaikversicherung-inter_2018-02/. An dieser Stelle wre auch ein Hinweis darauf angebracht, dass viele Versicherer Photovoltaikanlagen pauschal in den Versicherungsschutz einschlieen, zum Teil sogar einen Zuschlag dafr nehmen, dass eine Mitversicherung aktiv ausgeschlossen wird.
Auf Seite 66 wird ein Unterschied zwischen Solar- und Photovoltaikanlagen argumentiert:
Im Gegensatz zu Photovoltaikanlagen wandeln Solarthermieanlagen Sonnenlicht in Wrme um, die ausschlielich fr das versicherte Gebude genutzt wird und damit allein dessen wirtschaftlichen Zweck dient. Daher ist die Solaranlage als Gebudebestandteil versichert.
Nach dieser Argumentation mssten dann auch Photovoltaik-Inselanlagen, die nur der Versorgung des eigenen Wohngebudes und damit allein eigenen wirtschaftlichen Zwecken dienen, als Gebudebestandteil mitversichert sein.
Bume und Pflanzen sind auch Grundstcksbestandteile
Sehr bersichtlich und hilfreich ist hingegen die Darstellung der Unterschiede zwischen Einbau- und Anbaukchen (S. 67). Bei der Definition der versicherten Grundstcksbestandteile htte wie schon zur Vorauflage angemerkt der Verweis auf die abweichende Definition der 94 bis 96 BGB ergnzt werden knnen. Es wird allerdings betont, dass Bume keine versicherten Sachen seien und nur die abschlieend aufgezhlten Grundstcksbestandteile unter den Versicherungsschutz fallen (S. 71).
Ab Seite 75 widmen sich die Autoren dem Thema Bedarfsermittlung und Prmie. Besprochen werden hier unter anderem die Grundlagen fr die gleitende Neuwertversicherung (S. 75 – 78) oder wann der gemeine Wert mageblich ist (S. 84 – 85).
Neubau mit grerer Wohnflche kann problematisch sein
Schn ist der Hinweis auf den (in den meisten Tarifen) grundstzlich vorgeschriebenen Wiederaufbau eines Wohngebudes am gleichen Ort. Benannt werden aber auch Ausnahmen (siehe S. 80). Sehr ausfhrlich wird der Sonderfall behandelt, wo ein Versicherungsnehmer nach einem Totalschaden die Wohnflche um satte 37 % erhht (S. 80 – 82):
Jrgen und Liliane haben keinen Anspruch auf Neuwertentschdigung nach Ziff. 18.6 VGB, da das neu zu errichtende Wohnhaus ber eine wesentlich grere Wohnflche verfgen wird. Dies stellt eine von der Neuwertversicherung nicht erfasste Verbesserung dar.[3]
Tarifierung nicht zwingend auf Basis Wert 1914
Ganz offensichtlich ist es den Proximus‑Bedingungen geschuldet, dass die Autoren ausschlielich und ausfhrlich nur auf Wohngebudetarife mit Berechnung der Versicherungssumme Wert 1914 eingehen. Es sei jedoch erwhnt, dass mittlerweile gerade am Maklermarkt die Mehrzahl der Tarife fr Ein- und Zweifamilienhuser auf eine feste Versicherungssumme verzichten und vielmehr die Wohnflche zur mageblichen Kalkulationsgrundlage machen. Positiv ist in jedem Fall, dass klargestellt wird, dass der Wert 1914 keine absolute Entschdigungsgrenze darstellt (S. 89). Auch positiv ist der Hinweis, wonach eine nur geringfgige Unterversicherung den Versicherer nicht zur Krzung der Leistung berechtigt (S. 90).
Erhhte Erstattung versicherter Kosten anzuraten
Kapitel 4 ab Seite 93 behandelt das Thema Versicherte Kosten und versicherter Mietausfall. Hier bieten die Autoren einen wichtigen Hinweis zu der im Einzelfall sehr niedrigen Kostenpositionen im Rahmen der Musterbedingungen:
Viele Versicherer bieten daher die Mglichkeit, ber die Wahl von sog. Top- bzw. Premium-Deckungen die Entschdigungsgrenze fr solche Kosten deutlich zu erhhen. Derartige Deckungserweiterungen sind wrmstens zu empfehlen.[4]
Die Autoren gehen ferner auf das Zusammenspiel der Kostenposition Mietwertersatz (Wohngebudeversicherung) bzw. Hotelkosten (Hausratversicherung) ein. Dabei wird auch auf am Markt verfgbare Tarife mit sogar unbegrenzten Zeitrumen fr die Erstattung von Hotelkosten verwiesen (S. 96 – 97).
Meldung auch nicht versicherter Vorschden
Ab Seite 99 fhren Lemberg und Luksch in ihrem fnftenKapitel die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers aus. Hier werden u.a. die gesetzliche Schadenminderungspflicht, die vorvertragliche Anzeigepflicht oder auch die Heizobliegenheit ausgefhrt. Eine in der Praxis oft auftretende Problematik stellen Vorschden dar, die zwar beim Vorversicherer nicht gemeldet (und daher auch nicht reguliert wurden). Wenn im Rahmen eines Versichererwechsels jedoch nach Vorschden gefragt wird, gilt, dass auch nicht gemeldete Schden zu melden sind (S.108). Wer hier darauf verzichtet, nachzufragen, ob auch nicht gemeldete Schden anzuzeigen seien, mache sich den Autoren zufolge im Sinne von 276Abs.2BGB einer grob fahrlssigen Obliegenheitsverletzung schuldig (S.109).
Intransparente Klausel anzusprechen
Im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher und behrdlicher Obliegenheiten sei noch auf das Urteil des OLG Schleswig vom 18.05.2017 (Az. 16 U 14/17) hingewiesen. Im konkreten Fall hatte der beklagte Versicherer nach einem Leitungswasserschaden eingewandt, dass der Versicherungsnehmer angeblich gegen die DIN-Norm EN 806??5 verstoen habe, so dass er mit dieser Begrndung seine Leistung um 30 Prozent gekrzt hatte. Laut OLG sei die benannte Klausel intransparent und daher unwirksam[5]. Es wre schn, in der nchsten Auflage auf dieses Urteil hinzuweisen.
Positiv ist, dass die Autoren im Rahmen ihrer Ausfhrungen auch das Erfllen vertraglicher Obliegenheiten auf Basis einer Smart-Home-Einrichtung beachten (S. 111).
Vertragsbergang auch bei Gebudetausch
Kapitel 6 ab Seite 113 behandelt den Abschluss und Beginn eines Wohngebudeversicherungsvertrages. Hier erwarten den informierten Leser keine besonderen berraschungen. Interessanter ist hier Kapitel 7 ab Seite 117 zum Thema Vertragsbeendigung, wo unter anderem das bereits aus dem Grundlagenwerk zur Hausratversicherung bekannte Problem mit dem Poststreik besprochen wird (S. 117 – 119). Speziell bezogen auf die Wohngebudeversicherung wird daneben der bergang des Versicherungsschutzes vom bisherigen Versicherungsnehmer auf den Kufer (auch durch eine Auktion), Tauscher oder Beschenkten als neuen Immobilienbesitzer besprochen (S. 121 – 137). Hier wird ein wichtiger Rat an den Kufer einer Immobilie gegeben:
Dem Kufer kann man [] nicht raten, dem Kaufpreis zu zahlen, bevor der nicht auch den Versicherungsschein ber die bestehende Gebudeversicherung des Verkufers in den Hnden hlt.[6]
Darber hinaus raten die Autoren besser bereits mit Kaufpreiszahlung (auer bei Erwerb einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus) einen eigenen Versicherungsvertrag nach eigenen Wnschen zu gestalten, um im Schadensfall sicher eine Leistung verlangen zu knnen:
Eine Mehrfachversicherung i. S. d. 78 VVG liegt nicht vor, da jeder Vertrag von einem anderen Versicherungsnehmer abgeschlossen wurde.[7]
Nachweis bestehender Vorversicherung anzuraten
Ergnzend htte man noch auf den Fall eingehen knnen, bei dem der bisherige Immobilieneigentmer zwar einen Versicherungsschein vorlegen kann, jedoch arglistig darber hinwegtuscht, dass der Vertrag bereits gekndigt oder wegen Nichtzahlung nicht leistungspflichtig wre. Weiter wre es angezeigt gewesen, darauf hinzuweisen, dass eine Wohngebudeversicherung nur mit Zustimmung des Realrechtsglubigers gekndigt werden kann, sofern dieser seine Hypothek bei dem Versicherer angemeldet hat ( 143 I, 144 VVG). Eine entsprechende (vorlufige) Kndigungszurckweisung kann etwa wie folgt aussehen:
gerne wrden wir die Aufhebung zum Ablauf besttigen, aber im Falle einer Kndigung durch die Kunden, muss die finanzierende Bank dem zustimmen.[8]
Positiv ist, dass die Autoren wie auch in ihrem Buch zur Hausratversicherung (siehe dort S. 146) das Thema Spontanoffenbarungsfrist anreien (S. 140).
Einen Sonderfall stellen Erben dar, die ein Gebude infolge des Todes des bisherigen Versicherungsnehmers erwerben. Hier knne die bestehende Versicherung ordentlich frhestens zum Ende der Vertragslaufzeit gekndigt werden. (S. 123)
Zahlreiche Anhnge
An die vorhergehenden Kapitel anschlieend finden sich ein Literaturverzeichnis (S. 143 – 144), ein Abbildungsverzeichnis (S. 145 – 146), ein Anhang mit Allgemeine Wohngebude Versicherungsbedingungen des GDV (S. 147 – 173), ein Anhang 2 mit zustzlichen mglichen Vereinbarungen (S. 175 – 181), als Anhang 3 ein Gemeinsamer Allgemeiner Teil zu den Musterbedingungen (S. 183 – 200), Abweichungen und Ergnzungen (S. 201 – 209), eine Synopse der Proximus 5 VGB 2021 zu den GDV VGB 2022 (S. 211 – 215) sowie ein Stichwortverzeichnis (S. 217 – 219).
Fazit: Das Werk zur Wohngebudeversicherung richtet sich ganz klar an die Lernenden in Aus- und Weiterbildungsmanahmen sowie an deren Dozenten, so dass das Proximus-Bedingungswerk im Fokus aller Betrachtungen steht. Dadurch bleiben dann aber leider spannende Themen wie z. B. die Darstellung der unbenannten Gefahren, eine vertiefende Darstellung von Rauch- und Ruschden oder die Abgrenzung von Seng- zu Schmorschden, aber auch die Bercksichtigung von Tarifen auf Basis der Wohnflche anstelle des Wertes 1914 unvollstndig bzw. unerwhnt. Die Autoren hatten nach der zweiten Auflage eigentlich in Erwgung gezogen, solche Themen auch mit aufzunehmen, haben es am Ende aber dann doch nicht umgesetzt.
Dem erfahren Praktiker kann es aber zumindest insoweit einen Nutzen stiften, als man durch die mit aufgefhrten Bedingungen des GDV gleichzeitig auch den GDV-Standard auffrischen kann. Dort, wo die GDV-Bedingungen von den Proximus-Bedingungen abweichen, gibt es jeweils einen speziellen Hinweis mit Erluterungen. Zudem hilft die Proximus-GDV-Synopse im Anhang, um leichter zu erkennen, wo beide Bedingungswerke bereits im Aufbau voneinander abweichen. Weiterhin weist das Stichwortverzeichnis Eintrge sowohl fr Luftfahrzeug als auch fr Luftfahrzeuge auf.
Die nahezu doppelte Seitenzahl gegenber der zweiten Auflage ist teilweise dem Umstand geschuldet, dass diese im Unterschied zur jetzigen 3. Auflage keine Musterbedingungen abgedruckt hatte. Trotz der noch weiterhin offenen Themen und gewisser Kritikpunkte handelt es sich um eine hervorragende Einfhrung in die Materie, deren Lektre jedem Versicherungsvermittler dringend ans Herz gelegt wird. Auch fr alte Hasen bietet die Lektre sicher mancherlei Neues, zumindest jedoch eine grundlegende Auffrischung grundlegender Basics zum Thema.
[1] Lemberg, Jrg E. und Luksch, Andreas Wohngebudeversicherung. Eine Einfhrung anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft) 3. Auflage, 2024, S. 12.
[2] Lemberg, Jrg E. und Luksch, Andreas Wohngebudeversicherung. Eine Einfhrung anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft) 3. Auflage, 2024, S. 40.
[3] Lemberg, Jrg E. und Luksch, Andreas Wohngebudeversicherung. Eine Einfhrung anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft) 3. Auflage, 2024, S. 82.
[4] Lemberg, Jrg E. und Luksch, Andreas Wohngebudeversicherung. Eine Einfhrung anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft) 3. Auflage, 2024, S. 94.
[5] Siehe z. B. Hans Straer Sicherheitsklausel unwirksam auf hans-strasser.de vom 28.12.2021. Aufzurufen unter https://hans-strasser.de/sicherheitsklausel-unwirksam/, zuletzt aufgerufen am 12.01.2022.
[6] Lemberg, Jrg E. und Luksch, Andreas Wohngebudeversicherung. Eine Einfhrung anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft) 3. Auflage, 2024, S. 136.
Lemberg, Jrg E. und Luksch, Andreas Wohngebudeversicherung. Eine Einfhrung anhand praktischer Flle. Karlsruhe (Verlag Versicherungswirtschaft) 3. Auflage, 2024, S. 137.
[8] Kundenanschreiben aus dem Hause der Bayerischen.